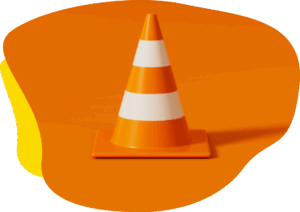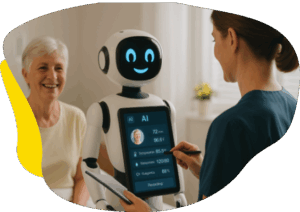EB-SRE Branchenforum – Finanzierung im Wandel: Investitionen in die Klimaneutralität der Sozialwirtschaft am 20. November 2025
Am 20. November fand das dritte Branchenforum des Jahres statt. Gastgeber Johannes Reinsch, Geschäftsführer der EB-SRE, begrüßte dabei Christian Schwarzrock, Leiter des strategischen Großkundenmanagements für Institutionen bei der Evangelischen Bank.
Zentrale Erkenntnisse aus dem EB-SRE Branchenforum
Das EB-SRE Branchenforum zeigte deutlich: Die Sozialwirtschaft steht mitten in einem tiefgreifenden Wandel – ökonomisch, strukturell und ökologisch. Um die Klimaziele zu erreichen und die Zukunftsfähigkeit sozialer Einrichtungen zu sichern, braucht es strategische Planung, Transparenz und neue Formen der Finanzierung.
- Klimaneutralität als strategische Aufgabe
Die Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen Investitionen unvermeidlich. Energetische Sanierungen, neue Wohn- und Versorgungsformen sowie digitale Prozesse prägen die kommenden Jahre. Der Wandel ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine dauerhafte Herausforderung, die aktiv gestaltet werden muss.
- Finanzierungsfähigkeit als neue Kernkompetenz
Banken und Investoren betrachten zunehmend nicht mehr nur einzelne Gebäude, sondern die strategische Gesamtaufstellung eines Trägers. Entscheidend ist, ob Organisationen wirtschaftlich stabil sind, eine klare Investitionsstrategie verfolgen und den eigenen Immobilienbestand aktiv steuern. Wer hier vorbereitet ist, verbessert seine Chancen auf Finanzierung erheblich.
- Transparenz schafft Handlungsspielräume
Viele Träger kennen den Zustand und die Wirtschaftlichkeit ihres Immobilienportfolios nicht genau. Eine systematische Bestandsaufnahme, etwa durch digitale Management-Tools, ist die Grundlage, um Sanierungsbedarf, CO₂-Emissionen und Investitionsprioritäten zu erkennen. Diese Daten sind nicht nur für Banken, sondern auch für Pflegesatz- und Kostenträgerverhandlungen zentral.
- Frühzeitige Investitionen rechnen sich
Beispielrechnungen zeigten: Wer jetzt in Energieeffizienz investiert, spart langfristig deutlich:bei Betriebskosten, CO₂-Abgaben und Instandhaltung. Abwarten hingegen erhöht die Gesamtkosten bis 2050 massiv.
- Fördermittel gezielt nutzen
KfW- und BAFA-Programme bieten weiterhin Unterstützung, etwa für Effizienzhaus-Standards oder Worst-Performing-Buildings. Allerdings sind die Verfahren komplex, oft an Lebenszyklusanalysen geknüpft und zeitlich begrenzt. Entscheidend ist, Förderchancen frühzeitig in die eigene Strategie einzubinden.
- Komplexität gemeinsam managen
Die vielseitigen Herausforderungen, von Fachkräftemangel über steigende Zinsen bis zu Reformstaus, lassen sich nur im gemeinsamen Dialog von Trägern, Verbänden und Finanzpartnern lösen. Kooperation, Datenaustausch und gemeinsame Strategien werden zur Voraussetzung für erfolgreiche Transformation.
Fazit
Investitionen in Klimaneutralität und nachhaltige Sozialimmobilien sind kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Entscheidend ist, dass Träger jetzt ihre Ausgangslage kennen, strategische Leitlinien entwickeln und handlungsfähig bleiben.
Oder, wie es Christian Schwarzrock formulierte:
„Nicht der Wind, sondern das Segelsetzen entscheidet.“